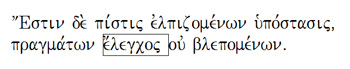Mit der jüngsten Enzyklika beschäftigte sich am 20.07.2008 in St. Margaretha (Wolfartsweier) der diesjährige END-Sektortag. Tobias Licht, der Leiter des erzbischöflichen Bildungswerks in Karlsruhe, hielt einen anregenden Vortrag über den Text der Enzyklika und über ihren Autor, Papst Benedikt XVI.
Anschließend bearbeiteten Kleingruppen jeweils einen Teil der Enzyklika. Den Text sowie Zusammenfassungen und Kommentare dazu gibt es an diversen Stellen im Internet (siehe
weiterführende Links zum Thema). Hier will ich nur einige Anregungen festhalten, die aus dem Vortrag oder den Kleingruppen erwachsen sind und Zitate anführen, die besonders zum Nachdenken angeregt haben.
»Christentum war nicht nur „gute Nachricht“ – eine Mitteilung von bisher unbekannten Inhalten. Man würde in unserer Sprache sagen: Die christliche Botschaft war nicht nur „informativ“, sondern „performativ“ – das heißt: Das Evangelium ist nicht nur Mitteilung von Wißbarem; es ist Mitteilung, die Tatsachen wirkt und das Leben verändert. Die dunkle Tür der Zeit, der Zukunft, ist aufgesprengt. Wer Hoffnung hat, lebt anders; ihm ist ein neues Leben geschenkt worden.«
Glaube ist Begegnung mit Gott und verändert real die Wirklichkeit - ähnlich wie ein Versprechen durch das Sprechen und Hören der Worte real etwas verändert. Ebenso
ändert der Glaube auch Beziehungen: Es bedeutet eine große Bereicherung für eine Partnerschaft, wenn man wissen darf, dass die Beziehung selbst noch einmal von Gott getragen ist und wenn man den Alltag gemeinsam vor Gott bringen kann, zum Beispiel im Gebet.
»Wie beim Bild des Philosophen, so konnte die frühe Kirche auch bei der Gestalt des Hirten an bestehende Vorbilder römischer Kunst anknüpfen. Der Hirte war dort weitgehend Ausdruck des Traums vom heiteren und einfachen Leben, nach dem sich die Menschen in der Wirrnis der Großstadt sehnten. Nun wurde das Bild von einem neuen Hintergrund her gelesen, der ihm einen tieferen Inhalt gab: „Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Muß ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil; denn du bist bei mir...“ (Ps 23 [22], 1.4).
Der wirkliche Hirt ist derjenige, der auch den Weg durch das Tal des Todes kennt; der auf der Straße der letzten Einsamkeit, in der niemand mich begleiten kann, mit mir geht und mich hindurchführt: Er hat sie selbst durchschritten, diese Straße; ist hinabgestiegen in das Reich des Todes, hat ihn besiegt und ist wiedergekommen, um uns nun zu begleiten und uns Gewißheit zu geben, daß es mit ihm zusammen einen Weg hindurch gibt. Dieses Bewußtsein, daß es den gibt, der auch im Tod mich begleitet und mit seinem „Stock und Stab mir Zuversicht“ gibt, so daß ich „kein Unheil zu fürchten“ brauche (Ps 23 [22], 4) – dies war die neue „Hoffnung“, die über dem Leben der Glaubenden aufging.«
Im 11. Kapitel des Hebräer-Briefes (Vers 1) findet sich eine Art Definition des Glaubens, die ihn eng mit der Hoffnung verknüpft.
Lässt man das Zentralwort zunächst unübersetzt, dann lautet der Satz:
»›Glaube ist Hypostase dessen, was man hofft; der Beweis von Dingen, die man nicht sieht.‹ Für die Väter und für die Theologen des Mittelalters war klar, daß das griechische Wort hypostasis im Lateinischen mit substantia zu übersetzen war. So lautet denn auch die in der alten Kirche entstandene lateinische Übertragung des Textes: „Est autem fides sperendarum substantia rerum, argumentum non apparentium“ – der Glaube ist die „Substanz“ der Dinge, die man erhofft; Beweis für nicht Sichtbares.«
Diese Übersetzung erscheint zunächst schwierig. In welchem Sinne könnte der Glaube ein Beweis sein? Es geht im Text mit Sicherheit nicht darum, dass etwas wahr sein müsste, nur weil es so viele Menschen glauben (denn viele Glaubende könnten ja auch irren) und auch nicht um Beweise im naturwissenschaftlichen Sinne. Der springende Punkt ist vielmehr, dass
»durch den Glauben anfanghaft, im Keim könnten wir sagen – also der „Substanz“ nach –, das schon da ist, worauf wir hoffen: das ganze, das wirkliche Leben. Und eben darum, weil die Sache selbst schon da ist, schafft diese Gegenwart des Kommenden auch Gewißheit: Dies Kommende ist noch nicht in der äußeren Welt zu sehen (es „erscheint“ nicht), aber dadurch, daß wir es in uns als beginnende und dynamische Wirklichkeit tragen, entsteht schon jetzt Einsicht.«
Der Text der Einheitsübersetzung greift aus dieser Sicht zu kurz:
»Glaube aber ist: Feststehen in dem, was man erhofft, Überzeugtsein von dem, was man nicht sieht.«
Das verwendete griechische Wort (elenchos) habe nämlich nicht die subjektive Bedeutung von „Überzeugung“, sondern die objektive Wertigkeit von „Beweis“.
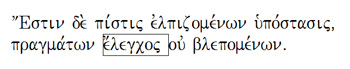
Das Wort „Beweis“ kann hier etwas in die Irre führen. Der Kerngedanke dieser anderen Übersetzung ist jedenfalls: Der Glaube ist nicht nur ein persönliches Ausgreifen nach etwas Kommendem, das noch ganz und gar nicht da wäre. Der Glaube gibt uns vielmehr schon jetzt etwas von der erwarteten Wirklichkeit. Ein „Beweis“, den auch Nichtglaubende sehen könnten oder gar müssten, ist das freilich nicht!
Doch dahin zielt der Gedanke an dieser Stelle auch nicht. Er zielt mehr auf die Glaubenden: Für sie ist diese gegenwärtige Wirklichkeit ein „Beweis“ für das noch nicht zu Sehende:
Der Glaube »…zieht Zukunft in Gegenwart herein, so daß sie nicht mehr das reine Noch- nicht ist. Daß es diese Zukunft gibt, ändert die Gegenwart; die Gegenwart wird vom Zukünftigen berührt, und so überschreitet sich Kommendes in Jetziges und Jetziges in Kommendes hinein.«
Viele wollen gar nicht das ewige Leben, sondern dieses jetzige Leben, und der Glaube an das ewige Leben scheint dafür eher hinderlich zu sein.
»Ewig - endlos - weiterzuleben scheint eher Verdammnis als ein Geschenk zu sein. Gewiß, den Tod möchte man so weit hinausschieben wie nur irgend möglich. Aber immerfort und ohne Ende zu leben – das kann doch zuletzt nur langweilig und schließlich unerträglich sein.«
»Eigentlich wollen wir doch nur eines – „das glückliche Leben“, das Leben, das einfach Leben, einfach „Glück“ ist. Um gar nichts anderes beten wir im letzten. Zu nichts anderem sind wir unterwegs – nur um das eine geht es. Aber Augustin sagt dann auch: Genau besehen wissen wir gar nicht, wonach wir uns eigentlich sehnen, was wir eigentlich möchten. Wir kennen es gar nicht; selbst solche Augenblicke, in denen wir es zu berühren meinen, erreichen es nicht wirklich. „Wir wissen nicht, was wir bitten sollen“, wiederholt er ein Wort des heiligen Paulus (Röm 8, 26).«
»Das Wort „ewiges Leben“ versucht, diesem unbekannt Bekannten einen Namen zu geben. Es ist notwendigerweise ein irritierendes, ein ungenügendes Wort. Denn bei „ewig“ denken wir an Endlosigkeit, und die schreckt uns; bei Leben denken wir an das von uns erfahrene Leben, das wir lieben und nicht verlieren möchten, und das uns doch zugleich immer wieder mehr Mühsal als Erfüllung ist …«
»Wir können nur versuchen, aus der Zeitlichkeit, in der wir gefangen sind, herauszudenken und zu ahnen, daß Ewigkeit nicht eine immer weitergehende Abfolge von Kalendertagen ist, sondern etwas wie der erfüllte Augenblick, in dem uns das Ganze umfängt und wir das Ganze umfangen. Es wäre der Augenblick des Eintauchens in den Ozean der unendlichen Liebe, in dem es keine Zeit, kein Vor- und Nachher mehr gibt. Wir können nur versuchen zu denken, daß dieser Augenblick das Leben im vollen Sinn ist, immer neues Eintauchen in die Weite des Seins, indem wir einfach von der Freude überwältigt werden.«
Nicht erst seit der Neuzeit (hier aber besonders) erhebt sich eine heftige Kritik an der Hoffnung auf das Ewige Leben: Sie sei purer Individualismus, der die Welt ihrem Elend überlasse und sich ins private ewige Heil geflüchtet habe. Dabei ist das Heil in der Bibel und der Theologie seit Urzeiten eigentlich immer als gemeinschaftliches gedacht worden.
»Der Hebräer-Brief selbst spricht von einer „Stadt“ (vgl. 11, 10.16; 12, 22; 13, 14), also von einem gemeinschaftlichen Heil. Entsprechend wird die Sünde von den Vätern als Zerstörung der Einheit des Menschengeschlechtes, als Zersplitterung und Spaltung aufgefaßt. Babel, der Ort der Sprachverwirrung und Trennung, erscheint als Ausdruck dessen, was Sünde überhaupt ist. Und so erscheint „Erlösung“ gerade als Wiederherstellung der Einheit, in der wir neu zusammenfinden in einem Einssein, das sich in der weltweiten Gemeinschaft der Gläubigen anbahnt.«
Wie entwickelte sich die Vorstellung, daß die Botschaft Jesu streng individualistisch sei und nur auf den einzelnen ziele?
»Das Heraufziehen einer neuen Zeit – durch die Entdeckung Amerikas und durch die neuen technischen Errungenschaften, die diese Entwicklung ermöglicht hatten – ist offenkundig. Worauf aber beruht diese Wende der Zeiten? Es ist die neue Zuordnung von Experiment und Methode, die den Menschen befähigt, zu einer gesetzmäßigen Auslegung der Natur zu kommen und so endlich „den Sieg der Kunst über die Natur“ (victoria cursus artis super naturam) zu erreichen.«
»Die Wiederherstellung dessen, was der Mensch in der Austreibung aus dem Paradies verloren hatte, hatte man bisher vom Glauben an Jesus Christus erwartet, und dies war als „Erlösung“ angesehen worden. Nun wird diese „Erlösung“, die Wiederherstellung des verlorenen „Paradieses“ nicht mehr vom Glauben erwartet, sondern von dem neu gefundenen Zusammenhang von Wissenschaft und Praxis. Der Glaube wird dabei gar nicht einfach geleugnet, aber auf eine andere Ebene – die des bloß Privaten und Jenseitigen – verlagert und zugleich irgendwie für die Welt unwichtig.«
Zugleich treten zwei Kategorien stärker ins Zentrum der Fortschrittsidee:
Vernunft und Freiheit. „Der Fortschritt ist vor allem ein Fortschritt in der zunehmenden Herrschaft der Vernunft, und diese Vernunft wird selbstverständlich als Macht des Guten und zum Guten angesehen.“ Alle Versuche der Neuzeit, die Herrschaft der Vernunft politisch-real aufzurichten oder gar das Reich Gottes auf Erden zu errichten, alle Entwürfe, die auf diese Weise zu viel vom Menschen und seiner Vernunft erwarteten, sind bisher gescheitert.
»Ja, Vernunft ist die große Gottesgabe an den Menschen, und der Sieg der Vernunft über die Unvernunft ist auch ein Ziel des christlichen Glaubens. Aber wann herrscht die Vernunft wirklich? Wenn sie sich von Gott gelöst hat? Wenn sie für Gott blind geworden ist? Ist die Vernunft des Könnens und des Machens schon die ganze Vernunft? Wenn der Fortschritt, um Fortschritt zu sein, des moralischen Wachsens der Menschheit bedarf, dann muß die Vernunft des Könnens und des Machens ebenso dringend durch die Öffnung der Vernunft für die rettenden Kräfte des Glaubens, für die Unterscheidung von Gut und Böse ergänzt werden. Nur so wird sie wahrhaft menschliche Vernunft. Sie wird menschlich nur, wenn sie dem Willen den Weg zeigen kann, und das kann sie bloß, wenn sie über sich hinaussieht.«
Das immer neue Ringen um die richtige Ordnung in Staat und Gesellschaft ist eine Aufgabe, die jeder Generation auferlegt ist; sie ist nie einfach zu Ende gebracht. Dabei ist der Anspruch an Mensch und Wissenschaft zwar groß, doch darf er nie zu hoch angesetzt werden:
»Nicht die Wissenschaft erlöst den Menschen. Erlöst wird der Mensch durch die Liebe. Das gilt zunächst im rein innerweltlichen Bereich. Wenn jemand in seinem Leben die große Liebe erfährt, ist dies ein Augenblick der „Erlösung“, die seinem Leben einen neuen Sinn gibt. Aber er wird bald auch erkennen, daß die ihm geschenkte Liebe allein die Frage seines Lebens nicht löst. Sie bleibt angefochten. Sie kann durch den Tod zerstört werden.
Er braucht die unbedingte Liebe. Er braucht jene Gewißheit, die ihn sagen läßt: „Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn“ (Röm 8, 38-39). Wenn es diese unbedingte Liebe gibt mit ihrer unbedingten Gewißheit, dann – erst dann – ist der Mensch „erlöst“, was immer ihm auch im einzelnen zustoßen mag. Das ist gemeint, wenn wir sagen: Jesus Christus hat uns „erlöst“. Durch ihn sind wir Gottes gewiß geworden …«
(Die Enzyklika nennt noch zwei weitere Lernorte:
II. Tun und Leiden als Lernorte der Hoffnung (35-40) und
III. Das Gericht als Lern- und Übungsort der Hoffnung (41-48). Diese beiden sowie das letzte Kapitel „Maria, Stern der Hoffnung (49-50)“ haben wir beim Sektortag nicht mehr eingehender betrachten können.)
»Ein erster wesentlicher Lernort der Hoffnung ist das Gebet. Wenn niemand mehr mir zuhört, hört Gott mir immer noch zu. […] Der Betende ist nie ganz allein.«
Sehr schön hat Augustinus in einer Predigt zum Ersten Johannes-Brief den inneren Zusammenhang von Gebet und Hoffnung dargestellt. Er definiert das Gebet als Übung der Sehnsucht.
»Der Mensch ist zum Großen geschaffen – für Gott selbst, für das Erfülltwerden von ihm. Aber sein Herz ist zu eng für das Große, das ihm zugedacht ist. Es muß geweitet werden. „Indem Gott die Gabe [seiner selbst] aufschiebt, verstärkt er unser Verlangen; durch das Verlangen weitet er unser Inneres; indem er es ausweitet, macht er es aufnahmefähiger [für ihn selbst].«
Diesen Gedanken können viele vielleicht nachvollziehen: Ohne das Gebet drohen Hektik und Oberflächlichkeit die Oberhand zu gewinnen; das Gebet weitet das Herz und macht uns im Alltag aufnahmefähiger für Gott - aber auch für die Menschen: „Rechtes Beten ist ein Vorgang der inneren Reinigung, der uns gottfähig und so gerade auch menschenfähig macht.“
Sehr schwer fällt es hingegen, die Gedanken zum „würdigen Beten“ nachzuvollziehen:
»Im Beten muß der Mensch lernen, was er von Gott wirklich erbitten darf – was Gottes würdig ist. Er muß lernen, daß er nicht gegen den anderen beten kann. Er muß lernen, daß er nicht um die oberflächlichen und bequemen Dinge bitten darf, die er sich gerade wünscht – die falsche kleine Hoffnung, die ihn von Gott wegführt. Er muß seine Wünsche und Hoffnungen reinigen. Er muß sich von seinen stillen Lügen befreien, mit denen er sich selbst betrügt: Gott durchschaut sie, und die Konfrontation mit Gott nötigt ihn, sie selbst zu erkennen.«
Andererseits wissen wir ja, dass wir geradewegs „ungefiltert“ mit unseren Gedanken „zu Gott kommen dürfen“, ohne erst die Bitten theologisch daraufhin überprüfen zu müssen, ob wir sie Gott vortragen dürfen.
Vielleicht schließen sich beide Gedanken ja auch gar nicht aus. Möglicherweise geht es um eine Haltung, in der man erst alles „ungefiltert“ und ehrlich vor Gott bringt, insgesamt aber zusammen mit Jesus am Ölberg beten kann: „Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir! Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen“ (vgl. Lk 22,42 und Mt 26,24).
Noch ein anderer Aspekt könnte gemeint sein; er klingt im darauf folgenden Absatz an: Die „Begegnung mit Gott weckt mein Gewissen, damit es nicht mehr Selbstrechtfertigung, Spiegelung meiner selbst und der mich prägenden Zeitgenossen ist, sondern Hörfähigkeit für das Gute selber wird“.
»Damit das Gebet diese reinigende Kraft entfaltet, muß es einerseits ganz persönlich sein, Konfrontation meines Ich mit Gott, dem lebendigen Gott. Es muß aber andererseits immer wieder geführt und erleuchtet werden von den großen Gebetsworten der Kirche und der Heiligen, vom liturgischen Gebet, in dem der Herr uns immer wieder recht zu beten lehrt.«
»Im Beten muß es immer dieses Ineinander von gemeinschaftlichem und persönlichem Gebet geben. So können wir mit Gott reden, so redet Gott zu uns.«
»So geschehen an uns die Reinigungen, durch die wir gottfähig werden und die uns befähigen, den Menschen zu dienen. So werden wir der großen Hoffnung fähig, und so werden wir Diener der Hoffnung für die anderen: Hoffnung im christlichen Sinn ist immer auch Hoffnung für die anderen. Und sie ist aktive Hoffnung, in der wir darum ringen, daß die Dinge nicht „das verkehrte Ende“ nehmen. Sie ist aktive Hoffnung gerade auch in dem Sinn, daß wir die Welt für Gott offenhalten. Nur so bleibt sie auch wahrhaft menschlich.«